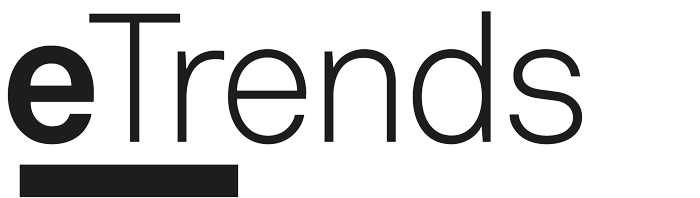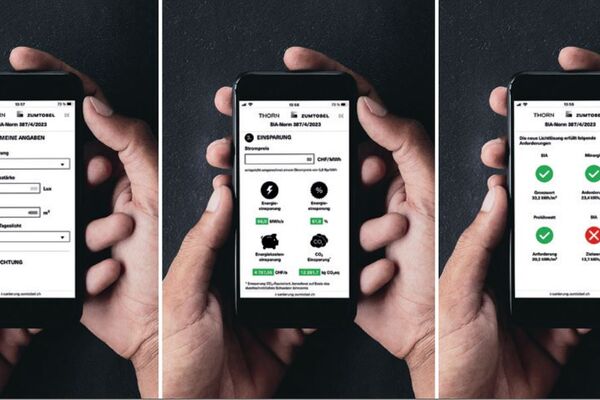An der «LichtWende» der Zumtobel Licht AG zeigten vier Projekte, wie Kreislaufwirtschaft im Bau funktionieren kann. Die Projekte liefern spannende Erkenntnisse zur Zirkularität, von denen auch die Elektrobranche profitieren kann.
Text: Nicola Senn
Fotos: René Senn
«LichtWende – Nachhaltige Innovationen von morgen» lautete der Titel der Veranstaltung, die am Nachmittag des 19. November 2025 bei der Zumtobel Licht AG in Zürich Oerlikon stattfand. Vier geladene Referentinnen und Referenten lieferten spannende Einblicke in nachhaltige Projekte mit zirkulärem Anspruch: einen Bau, der den Aushub gleich in die Decken packte, ein zirkulär konzipiertes Beachvolleyballcenter und eine «Dating-Plattform» für ausgediente Büromöbel. Den für die rund 100 anwesenden Gäste angerichteten Abend eröffnete Dominik Wäger, Geschäftsführer Zumtobel Schweiz. Anschliessend moderierte Markus Telser, Markenverantwortlicher von Zumtobel Schweiz, die Veranstaltung und leitete die Referate ein.
Nach 30 Jahren ein Kraftwerk

Bettina Baggenstoss, Leiterin Nachhaltiges Bauen bei Blumer Lehmann AG und Co-Founderin von Lehmit GmbH, eröffnete die Referatreihe mit einer Blankofolie: «Hier sehen Sie das nachhaltigste Gebäude der Welt.» Nach den Lachern des Publikums ordnete sie schnell ein, dass es sich grundsätzlich um eine grosse Herausforderung handle, Gebäude nachhaltig zu gestalten. Die Blankofolie mit einem nachhaltigen Bau zu füllen, war der Anspruch des Projektteams des HORTUS in Allschwil, welches Baggenstoss anschliessend detailliert vorstellte. Der Name steht für «House of Research, Technology, Utopia, Sustainability» und ist Programm. Baggenstoss machte klar: «Zirkularität muss von Anfang an in Bauprojekten mitgeplant werden. Sie lässt sich nicht erst nachträglich hineindenken.»
Beim Hortus-Bau beginnt dieser Ansatz bereits beim Material. Holz aus der Region bildet das Skelett, Erde aus dem Aushub wird zu Lehm für die Verbunddecken verarbeitet. Das Resultat ist ein natürliches Bürogebäude mit Mischnutzungsflächen, das die Kreisläufe der eingesetzten Materialien konsequent berücksichtigt. Die energetische Bilanz überzeugt: Nach gut 30 Jahren soll sich das Gebäude amortisiert haben. Von da an produziert es mehr Energie, als es verbraucht, auch dank der in die Fassade integrierten Solarpanels. Das präsentierte Monitoring des Projekts zeigt, dass die Anforderungen der Bauherrin nicht nur erfüllt, sondern gar übertroffen wurden. Mindestanforderungen wurden hier nicht als Zweck gesehen, sondern als Anreiz, sie zu überbieten.

Nachhaltigkeit im Fassadenbau
Auch beim Referat von Lena Windler, Leiterin Sustainability bei Sto AG Switzerland, stand die Nachhaltigkeit beim Bau im Vordergrund. Das Unternehmen für Gebäudebeschichtung und -dämmung aus dem Schwarzwald (DE) verfolgt dabei einen ganzheitlichen Ansatz. Jedes Produkt soll durch Energieeinsparung, Klimaschutz oder Steigerung von Gesundheit und Wohlbefinden zur Nachhaltigkeit beitragen. Wärmedämmsysteme leisten einen zentralen Beitrag und helfen, Wärmeverluste von Fassaden deutlich zu verringern. Eine zentrale Rolle spielen auch die eingesetzten Rohstoffe, die in ihrer Umweltwirkung optimiert werden sollen. Wenn möglich kommen nachwachsende Rohstoffe zum Einsatz. Die Vielzahl verschiedener Anforderungen und Label im Bau sind allerdings eine Herausforderung und stellen Hersteller vor komplexe Aufgaben. Bauprodukte müssten deshalb Informationen liefern, die eine Bewertung im Gebäudekontext ermöglichen.

Kreislauf im Beachvolleyball

Nach einer kurzen Pause führte Fritz Mühlethaler die Gäste in eine andere Welt, jene des Sports. Der Gesamtprojektleiter präsentierte das «Home of Beach» in Bern, die neue Beachvolleyball-Anlage für den Breiten- und Spitzensport. Mit zwölf Feldern wird sie die grösste Beachsport-Infrastruktur der Schweiz und gleichzeitig das neue nationale Leistungszentrum.
Auch hier stand Zirkularität bereits bei Planungsbeginn im Zentrum. In diesem Fall im Rahmen eines Projekts, welches in Form eines Public-Private-Partnership-Modells umgesetzt wird. Mühlethaler zeigte an konkreten Beispielen, wie durchdacht das Projekt angelegt ist. Aufgrund mangelnder Fläche in der Stadt ist die Bauweise verdichtet, vier Volleyballfelder wurden auf dem Dach platziert. Die Stahlhalle des bisher genutzten und ausgedienten Beachcenters wird nicht verschrottet, sondern abgebaut und an ein Feuerwehrmagazin im Tessin weitergegeben. Im Bau selbst kommt darüber hinaus Zirkulit-Beton zum Einsatz, ein Beton mit einem hohen Anteil an Sekundärmaterial. Auch der Sand der alten Beachvolleyball-Halle wird wiederaufbereitet und weiterverwendet.

Das Projekt soll neue Standards setzen. Nicht nur im Sportbereich, sondern vor allem bei Kreislaufwirtschaft und CO₂-Reduktion. Auf die ersten Duelle dürfen sich sowohl Hobby- als auch Leistungssportler:innen ab Winter 2026 freuen, wenn die Anlage offiziell eröffnet werden soll. Das Beispiel des Home of Beach zeigt anschaulich, dass nachhaltige Ansätze auch in unerwarteten Sektoren gefragt sind.
«Tinder für Möbel»
Den Abschluss machte Björn Ischi von Ischi Designform GmbH. In einem unterhaltsamen und zugleich praxisnahen Vortrag zeigte der Experte für Circular Design, wie sich selbst komplexe Probleme durch kreative Ansätze nachhaltig lösen lassen. Sein Beispiel: Das Upcycling-Projekt «Mymyio» für Büromöbel.

Die Idee ist bestechend einfach. Mit einer Wertstoff-Cloud erfasst Mymyio die sogenannten «Altmöbel-Lieferanten», Unternehmen, die ihr Büromobiliar nicht mehr weiterverwerten können. Sie können ihre Möbel selbst auf der Plattform anlegen und Fotos hochladen. «Die Plattform funktioniert wie eine Art Tinder für Möbel», erklärte Ischi. Eine KI-basierte Bilderkennung identifiziert die Bestandteile ausgedienter Möbel und ermittelt, welche sich für die Produktion der eigenen Produktlinie eignen.
Das Ziel ist ambitioniert: Mymyio will Upcycling im Möbelbereich als Katalogproduktion etablieren. Statt Einzelstücke sollen Standardprodukte aus dem Katalog angeboten werden, hergestellt aus wiederverwendeten Materialien. Für die Baubranche ist das ein interessantes Modell. Es zeigt, wie Skalierbarkeit und Kreislaufwirtschaft zusammenpassen können.
Kompetenzen zur Lösungsfindung sind gefordert
Die vier Referate der LichtWende bei der Zumtobel zeigen, dass Kreislaufwirtschaft kein Nischenmodell ist, sondern zunehmend zur Anforderung wird. Die Zirkularität muss dabei von Beginn an geplant und berücksichtigt werden. Mit einem Monitoring und messbaren Indikatoren kann schwarz auf weiss aufgezeigt werden, wie erfolgreich ein Projekt ist. Die Technologie kann genutzt werden, um Ideen zu skalieren. Ob KI-gestützte Bilderkennung bei Möbeln oder intelligente Steuerungssysteme in Gebäuden: Digitale Lösungen helfen, nachhaltige Ansätze vom Einzelprojekt bis zum Standard zu entwickeln. Für erfolgreiche Zirkularität braucht es darüber hinaus aber vor allen Dingen die Kompetenzen, komplexe Problemstellungen anzugehen. An diesem Punkt entstehen Innovationen, wie die Beispielprojekte bei der LichtWende in Zürich anschaulich demonstrierten.
Impressum
Text: Nicola Senn
Fotos: René Senn
Informationen
Veröffentlicht am: