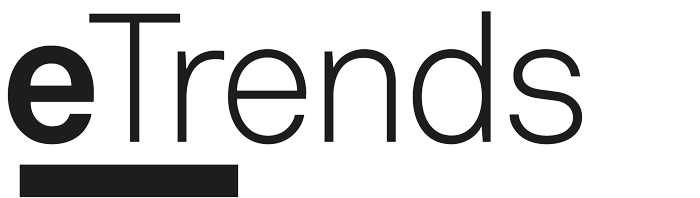Sensorik kann effiziente LED-Leuchten noch effizienter machen. Wo liegen die Herausforderungen? Wir haben den Experten Stefan Gasser gefragt. Er hat einige spannende Antworten für uns.
Interview: René Senn
Fotos: Susanne Seiler
Im Rahmen unseres sehr umfassenden Artikels zur Integration von Sensorik in LED-Beleuchtungssysteme (S. 50 Printausgabe) haben wir mit Stefan Gasser von der Schweizer Licht Gesellschaft (SLG), einem ausgewiesenen und langjährigen Experten im Bereich Licht, zu einem Gespräch getroffen. Wir wollten von ihm erfahren, welchen Stellenwert die Sensorik in Beleuchtungsanlagen hat und wo noch am meisten Aufklärungsbedarf besteht.
Sensorik immer wichtiger
«Wir haben viel erreicht – es geht noch mehr», unter diesem Motto führte die SLG im Herbst den zweiten energylight day durch, bei dem ein Schwerpunkt auf der Sensorik lag (siehe eTrends 05/24, S. 36). Während LED-Leuchten heute bereits Standard sind und signifikante Energieeinsparungen ermöglichen, können sie ihr volles Potenzial erst mit Sensorik ausspielen. Im Interview wollen wir gemeinsam herausfinden, welche Herausforderungen und Möglichkeiten der Einsatz von intelligenten Steuerungssystemen bietet und welche Rolle die SLG und die Branche dabei spielen. Stefan Gasser hat mit uns seine Einschätzungen zu den aktuellen Entwicklungen, den noch bestehenden Herausforderungen und den zukünftigen Handlungsfeldern im Bereich LED, kombiniert mit Sensorik, geteilt.
Stefan Gasser, LED-Leuchten sind heute Standard, und die SLG hat sehr viel dafür getan. Gratulation!
Vielen Dank. Wir haben in der Tat viel erreicht, aber es gibt auch noch einiges zu tun.
Wo kann die SLG jetzt noch etwas bewirken?
In drei Bereichen: beim Einsatz der Sensorik, ihrer korrekten Einregulierung und auch bei der optimierten Nutzung des Tageslichts. In allen besteht noch viel Luft nach oben.
Welche Anstrengungen unternimmt die SLG, um die Integration von Sensorik weiter voranzutreiben?
Ein Aufgabengebiet, das wir aktuell intensiv verfolgen ist, bei fertiggestellten Projekten Messungen durchzuführen. So können wir aufzeigen, dass der Einbau und die richtige Justierung der Sensorik in der Praxis sehr grosse zusätzliche Einsparungen ermöglichen. Am SLG College bieten wir übrigens ein umfassendes Weiterbildungsprogramm zu dieser Thematik an.
Verdoppelung der Einsparungen dank Sensorik
Gibt es Kennzahlen zu den Einsparungen dank Sensorik?
Je nach Projekt erreicht man eine Verdoppelung der Einsparungen gegenüber einer reinen Umstellung von herkömmlicher auf LED-Technologie ohne Sensorik.
Wo siehst du die grösste Problematik für die flächendeckende Nutzung von Sensorik?
Ich würde sagen, es gibt zwei grundlegende Hemmnisse, die noch beseitigt werden müssen. Das eine hat mit der Vergangenheit zu tun, als die Sensorik häufig nicht so funktionierte, wie man es erwartet hat. Man hat deshalb eine gewisse Angst, dass es zu Fehlschaltungen kommen könnte oder dass das Licht im falschen Moment einschaltet usw. Das zweite Hemmnis ist die neue Technologie. Während LED bedenkenlos x-mal geschaltet werden können, war dies bei FL-Leuchten nicht gewünscht, weshalb sie oft im Dauerbetrieb betrieben wurden. Diese zwei Punkte sind heute jedoch kein Thema mehr.
Hat es auch etwas mit der Komplexität zu tun?
Ja. Es ist technologisch anspruchsvoller, eine Beleuchtung mit Sensorik umzusetzen als in einem Raum alte Leuchten 1:1 durch LED zu ersetzen, die alle dieselbe Beleuchtungsstärke haben. In einem solchen Fall muss ich mir keine Gedanken machen über die Platzierung der Sensoren und vieles mehr.
Hast du uns Beispiele zum Einsatz von Sensorik?
Für die SLG sind vor allem die Beispiele interessant, die keine Standardlösungen wie in Korridoren und Schulzimmern nutzen, sondern Orte, an denen man typischerweise keine Sensorik erwartet. Drei Projekte kommen mir dazu spontan in den Sinn: Das eine ist die SBB-Werkstätte in Zürich, das zweite eine Industriehalle der SIG in Neuhausen am Rheinfall und ein weiteres das Spital Biel. Die drei Beispiele zeigen, dass auch in solchen Anwendungen Sensorik eingesetzt werden kann und dies in der Praxis auch funktioniert.
Licht- und Elektroplaner müssen Bauherrschaft motivieren
Wie wichtig sind Fördergelder für den Erfolg solcher Projekte?
Der Einbau von Sensorik bewirkt häufig eine Verdoppelung der Einsparung. Das ist für das ermittelte Einsparpotenzial und damit das Ziel von energylight ein entscheidender Faktor. Lösungen mit Sensorik sind zwar häufig etwas teurer, aber dann dank den Fördergeldern auch etwas interessanter, weil die Gelder die Hemmschwelle für den Einsatz von Sensorik mindestens von der finanziellen Seite her senken. Mehr dazu unter: www.lightbank.ch.
Wie lange gibt es die Fördergelder noch?
Aktuell ist die Förderung bis 2027 sichergestellt. Wie es danach weitergeht, ist noch offen.
Was ist die Aufgabe der Planer und Installateure, wenn es um die richtige Integration von Sensorik geht?
Licht- und Elektroplaner müssen die Bauherrschaft motivieren und darauf aufmerksam machen, dass Sensorik zusätzliches Einsparpotenzial bedeutet. Und dann spielt natürlich die richtige Auslegung eine Rolle. Hier möchte ich auf das neue Projekt von senseNORM, also der Vereinigung von Markenherstellern im Bereich der Bewegungs- und Präsenzmelder, hinweisen. Es wurde eine Software entwickelt, die von Relux Informatik AG programmiert wurde, die mit den technischen Daten von Sensoren arbeitet. Die nötigen Sensordaten werden dazu vorab bei METAS (eidgenössisches Institut für Metrologie) nach einer speziellen Vorgabe korrekt und vergleichbar ausgemessen. Dies erhöht die Planungssicherheit in der Praxis massiv.
Und die Installateure?
Sie müssen unbedingt auf die korrekte Inbetriebnahme achten, also die Nachlaufzeiten, das Beleuchtungsniveau und die Gruppen richtig einstellen.
Ein wunder Punkt?
Oh ja, oder Auftragspotenzial für gute Elektriker. Ein Projekt, das wir mit der Hochschule Luzern zusammen realisieren haben, hat dies deutlich gezeigt. Mit einem richtig in Betrieb genommenen Sensor kann gegenüber einem Sensor, der mit den Werkseinstellungen installiert wird, doppelt so viel Energie eingespart werden.
Bessere Zusammenarbeit zwischen Leuchtenfirmen und Sensorherstellern gefragt
Was erwartet die SLG von der Branche, um Fortschritte bei der Effizienz von Beleuchtungssystemen zu erzielen, Stichwort Davos?
Dass die Branche aktiv mitmacht und uns mit einbezieht, damit wir Beispiele, die beweisen, wie viel Sensorik bringt, entsprechend publizieren können. Es geht eigentlich darum, die Vernetzung, die wir mit energylight ja hauptsächlich anstreben – also den Austausch an Tagungen, Seminaren und in einzelnen Projekten – noch aktiver zu fördern. So können wir mehr Projekte kennen lernen und publizieren.
Ist die Leuchtenindustrie schon bereit, während die Branche insgesamt vielleicht noch etwas hinterherhinkt?
Man kann durchaus sagen, dass die Leuchtenindustrie ihre Arbeit gemacht hat. Heute ist alles auf LED umgestellt. Beim Thema Sensorik hinken wir jedoch hinterher. Man kann der Sensorikbranche zwar keinen direkten Vorwurf machen, aber es ist sicher so, dass dort noch mehr passieren muss, auch in Bezug auf eine bessere Zusammenarbeit zwischen Leuchtenfirmen und Sensorherstellern. Die Vernetzung von Sensoren und Leuchten spielt hier eine zentrale Rolle, weil man dadurch wirklich das Optimum herausholt.
In der Sensorik-Übersicht, die dir auch vorliegt, gehen wir auf die unterschiedlichen Lösungen ein. Wie siehst du diese Vielfalt?
Diese Vielfalt ist wichtig, denn je nach Anforderungen kommen unterschiedliche Lösungen zum Einsatz. Es gibt einfache Ein-Aus-Sensoren, die nur eine Leuchte steuern, aber auch vollvernetzte Gebäudesysteme, die neben der Beleuchtung auch andere Gewerke integrieren. Diese Vielfalt und Struktur als Übersicht darzustellen, finde ich sehr gut. Gleichzeitig sollte man sich bei jedem Projekt immer wieder die Frage stellen, ob es noch Optimierungspotenzial gibt. Kurz gesagt: Die Vernetzung mit Sensorik lieber eine Stufe höher wählen als eine tiefer.
Um auf die Frage der richtigen Inbetriebnahme zurückzukommen: Egal welches Konzept bzw. Stufe, oft werden die Systeme nicht richtig konfiguriert?
Ja, das kann man leider so sagen.
Sensorik-Zertifikat wäre interessant
Was könnte getan werden, damit die installierten Lösungen auch wirklich optimal in Betrieb genommen werden?
Ich habe mir schon überlegt, ob hier vielleicht ein Label oder Zertifikat helfen könnte, um diese Sicherheit zu schaffen. Mir kommt hier das Beispiel der italienischen Weine in den Sinn, die eine Zeit lang qualitativ nicht mehr so gut waren. Dann wurde das Label DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita) eingeführt um sicherzustellen, dass die Herkunft und Qualität garantiert sind. Ähnlich könnte ein Sensorik-Zertifikat dafür sorgen, dass die Anwender wissen: Wenn sie eine bestimmte Sensorlösung bestellen, ist ihnen garantiert, dass diese korrekt betrieben wird. Das sind erste Überlegungen. Aber die Idee, ein Optilight-Label zu kreieren, wäre vielleicht wirklich interessant.
Mangelt es an der Weiterbildung in der Branche oder ist es ein Zeitproblem?
Es ist definitiv ein Informationsproblem, und der ständige Druck in der Branche spielt auch eine Rolle – das Thema hat oft keine Priorität. Hier hilft nur, kontinuierlich zu informieren, Vertrauen zu schaffen und gute Beispiele zu zeigen. Förderprogramme unterstützen ebenfalls, da sie meist nur dann echte finanzielle Hilfe bieten, wenn auch Sensorik integriert wird.
Wie siehst du die Zusammenarbeit der verschiedenen Verbände im Bereich der Sensorik und Beleuchtungstechnik?
Da gibt es sicher noch Optimierungsmöglichkeiten, auch wenn wir mit einigen Verbänden bereits sehr gut zusammenarbeiten. Es gibt aber noch einige Verbände, mit denen mehr Zusammenarbeit möglich wäre, weil die dasselbe Zielpublikum ansprechen wie wir, zum Beispiel Electrosuisse oder SwissGE. Dass sie eine wichtige Rolle in der Information und Weiterbildung spielen, steht ausser Frage.
Wie wichtig ist die Zusammenarbeit mit EnergieSchweiz?
Wenn der Bund solche Initiativen unterstützt, steigert das die Glaubwürdigkeit der SLG-Projekte, da nur wichtige Vorhaben gefördert werden. Denn so viel Einsparung wie beim Licht ist nirgendwo möglich. Eine Unterstützung durch den Bund hilft, diese Erkenntnis weiter zu verbreiten. EnergieSchweiz kann hier viel bewirken, eventuell sogar durch ein Label.

Letzte Frage: Stell dir vor, es kommt eine strahlende Licht-Fee, und du hast einen Wunsch frei. Welcher wäre es?
Ah, die Wunderfrage! Mein Wunsch wäre ein Sensor, der so intelligent ist, dass er sich von selbst perfekt einstellt: die optimale Beleuchtungsstärke erkennt, das vorhandene Tageslicht berücksichtigt und genau weiss, wann er das Licht ausschalten soll. Ein solcher Wundersensor würde uns viel Schulungs- und Informationsarbeit ersparen und die Anwendung enorm vereinfachen.
Impressum
Textquelle: René Senn
Bildquelle: Susanne Seiler
Informationen
Veröffentlicht am: