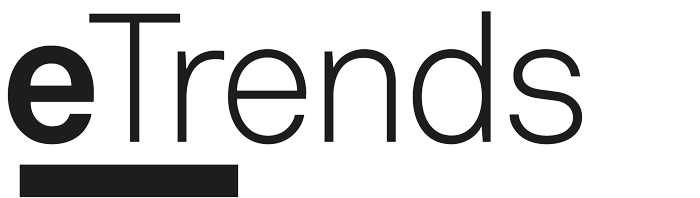Innovation & Tradition
ADRIAN ALTENBURGER

Innovation & Tradition
ADRIAN ALTENBURGER
Adrian Altenburger ist Professor an der Hochschule Luzern – Technik & Architektur HSLU, Instituts- und Studiengangleiter Gebäudetechnik und Energie IGE, Vizepräsident im SIA und Präsident der zentralen Normenkommission ZN sowie Verwaltungsrat in verschiedenen Planungs- und Industrieunternehmen.
Ein Gastbeitrag zum Thema Innovation und Tradition
Bauen ist nicht nur für mich als Ingenieur faszinierend, sondern hat wohl eine besondere gesellschaftliche Relevanz. Meine Familie «darf» das jeweils bei unseren Fahrten und Gängen vorbei an Bauten, an denen ich als Planer beteiligt sein durfte, aufgrund meiner Kommentare zur Kenntnis nehmen. Keine andere menschliche Aktivität manifestiert sich sichtbarer als die gebaute Umwelt. Die Ikonen ihrer Zeit überleben nicht nur Generationen, sondern ganze Epochen und sind deshalb stark verankerte Abbilder einer lokalen Kultur und Wertegemeinschaft. Die Bauindustrie steht somit nicht nur in einer besonderen Verantwortung, sondern ist auch stark von Traditionen geprägt.
Irrungen und Wirrungen
Versuche, solche Traditionen zu verlassen, werden zwar oft unternommen, scheitern aber häufig kläglich oder bedingen eine vertiefte systemische Auseinandersetzung und somit Zeit. Sinnbild einer gescheiterten Abkehr von Bautraditionen sind für mich die Glasbauten der 90er-Jahre, und ein Beispiel für eine Entwicklung, die mehr Zeit und systemische Verbesserungen bedingte, ist die thermische Bauteilaktivierung. Erstere wurden mit entsprechend überdimensionierter Technik einigermassen nutzbar gemacht, aber spätestens mit dem verstärkten Bewusstsein für ökologisch nachhaltigeres Bauen zumindest in der Schweiz als Irrweg erkannt. Letztere wurde bereits in den 60er-Jahren praktiziert, bedingte aber zunächst eine markante Verbesserung der Fensterdämmwerte, um entsprechend tiefere Heizwassertemperaturen und somit für den Nutzer komfortable Deckentemperaturen zu gewährleisten. Solche zwar disziplinär durchaus spannenden Ansätze zeigen immer wieder, dass das Gebäude als System zu denken und zu bauen ist und nicht einfach die Summe aller disziplinären Beiträge darstellt. Bei uns an der HSLU ist dieser Ansatz der interdisziplinären Lösungsfindung stark verankert und wird sowohl in den Studiengängen als auch in der Forschung sozusagen als «raison d’être» gepflegt.
Segmentierung als Hindernis
Die genannten Beispiele zeigen exemplarisch eine historisch gewachsene Problematik, die sich bis heute fortsetzt und aus meiner Sicht das Kernproblem von nicht nachhaltigen Entwicklungen im Bauwesen ist. Während das Bauen historisch durch einen gesamtverantwortlichen Baumeister geprägt war, hat insbesondere die Industrialisierung und damit der Einzug der Technik zu Spezialistentum und zu weniger holistischen Lösungen geführt. Dass wir aufgrund der komplexeren Anforderungen kaum zurück zum klassischen Baumeister gehen, der von der Planung bis zur Ausführung und vom Tragwerk bis zur integrierten Gebäudeautomation alles versteht, ist selbstredend.
Nun stehen wir aber technologisch dank den Entwicklungen in der Informatikindustrie vor der Möglichkeit, die Planungs- und Bauprozesse digital und gesamtheitlich abzubilden − als Modell mit allen notwendigen und relevanten Informationen, das heisst mittels Building Information Modeling (BIM). Dass dieser zunächst methodische Ansatz eine zeitsynchrone Entwicklung des Modells und somit der Informationen bedingt, war dem Vorstand des SIA schon früh klar, vielen anderen aber nicht. Statt einfach wie die meisten loszumarschieren und nirgends anzukommen, äusserte ich als Verantwortlicher für das SIA-Normenschaffen die klare Absicht, zunächst eine erste normative Grundlage zu schaffen. Das Merkblatt 2051 BIM auszuarbeiten, beanspruchte zwar Zeit, aber es entstand auch die bis heute europaweit einzige interdisziplinäre normative Grundlage zu dieser Methodik.
Integration als Digitalisierungsschlüssel
Mit der Normierung werden zwar wichtige Rahmenbedingungen geschaffen, aber selten strukturelle Veränderungen bewirkt. Diese wären aber nicht nur notwendig, sondern stellen eine in sich logische Weiterführung des eingeschlagenen Wegs dar. An der HSLU starten wir deshalb im Herbst 2020 mit dem Bachelorstudiengang «Digital Construction», der alle Disziplinen vereint, also ein gemeinsames Verständnis für Analyse-, Planungs- und Umsetzungskompetenzen schafft und trotzdem disziplinäre Grundkompetenzen als Vertiefung sicherstellt. Ganz nach dem Motto «keine Zukunft ohne Herkunft». Der Studiengang ist eine klare Alternative zu all den in den letzten Jahren neu am Markt aufgetauchten BIM-Spezialisten und -Beratern. Meine Vision geht aber weiter und beschränkt sich nicht nur auf das bildungstechnische Selbstverständnis der interdisziplinären Autorenschaft im Team. Nein, ich würde mir wünschen, dass die jungen Architekten/innen und Ingenieure/innen in Zukunft auch in Unternehmen arbeiten, die gesamtverantwortlich agieren. Aber nicht wie heute projektspezifisch organisiert, sondern tatsächlich als horizontal und vertikal integrierte unternehmerische Eigenleistung.
Impressum
Fotos: Susanne Seiler
- #Bauen
- #Bildung
- #Energie
- #Forschung
- #Hochschule
- #HSLU
- #Innovation
Veröffentlicht am: