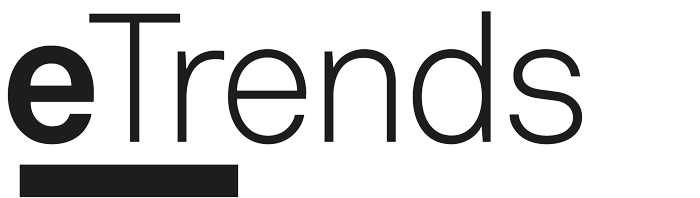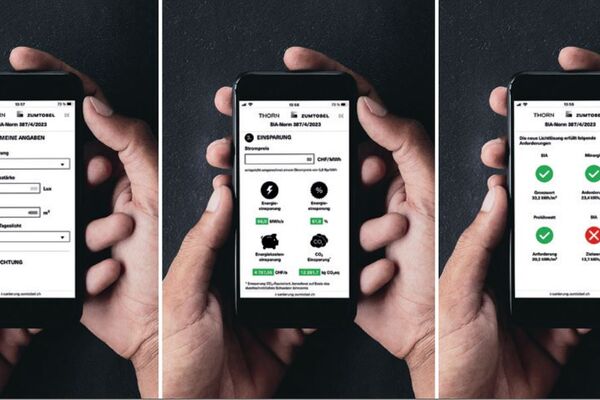Es gibt gute Gründe dafür, dass Schutz und Rettung Zürich auf eine 50-kW-DC-Ladestation setzt. Wir waren bei der Inbetriebnahme dabei.
Text: René Senn
Fotos: Michael Donadel
Wenn man über Schnellladen spricht, ist man verführt zu denken: schnell, schneller, am schnellsten. 300 kW+? Her damit! Was, 400 kW? Noch besser. Doch diese Logik greift im Alltag oft zu kurz. Schnellladen bringt auch grosse Herausforderungen mit sich wie hohe Anschlussleistungen sowie den Bedarf an performanten Netzanschlüssen und einer aufwändigen Infrastruktur.
Wer auf Autobahnen unterwegs ist, profitiert zweifellos von jedem zusätzlichen kW. Doch oft ist dort schon heute das Auto das Limit – und die Pause dauert länger als der Ladevorgang. Wir merken: Das ökonomische Laden muss im Verhältnis zu verschiedensten Parametern stehen, sonst ist es an mindestens einer Stelle unwirtschaftlich.
Langsam laden
Im gewerblichen Umfeld geht es beim Laden nicht um Sekundenjagd, sondern um praktikable Lösungen mit echten Vorteilen für den Alltag. Eine typische AC-Wallbox liefert in der Regel 11 kW, weil die meisten Fahrzeuge dort gar nicht schneller laden können. Damit dauert eine Vollladung vier Stunden oder mehr. Im privaten Umfeld ist das meist das Richtige, denn dort steht das Auto oft ganz lange neben der Wallbox. Aber für viele Betriebe bzw. Anwendungen ist das zu langsam. Zum Glück gibt es auch dafür passende Lösungen.
Mittelschnell laden
In Autohäusern, bei Flottenbetreibern oder in Gewerbebauten müssen E-Fahrzeuge zügig wieder einsatzbereit sein. Zum Beispiel nach einer Probefahrt, vor einer Fahrzeugübergabe oder nach einem kurzen Kundentermin. Auch in einem Shopping Center macht es einen Unterschied, ob das Auto nach 30 Minuten wieder zu 80% geladen ist – oder sich kaum etwas getan hat. DC-Lader mit einer Ladeleistung zwischen 20 und 50 kW sind hier die perfekte Lösung. Sie laden bis zu fünfmal schneller als eine klassische 11-kW-Wallbox, und der Hausanschluss reicht in vielen Liegenschaften dafür aus.
Ein dynamisches Lastmanagement regelt die Leistung des Schnellladers und schützt den Hausanschluss. Fahrzeuge, die nur kurz stehen, lassen sich so effizient zwischendurch laden. In einer Stunde ist der Akku meist voll – in einer halben Stunde schon auf einem akzeptablen Niveau für die Weiterfahrt.

Auch der Krankenwagen fährt elektrisch
Ein Beispiel für den praktischen Einsatz einer 50-kW-DC-Ladestation sehen wir bei Schutz und Rettung Zürich am Flughafen. Die Station wurde in diesem Frühjahr für die Einsatzfahrzeuge installiert. Wir waren bei der Inbetriebnahme dabei und wollten genau wissen, wie sie und die vorgängige Installation abliefen.
Die Station ist ein Hypercharger HYC50 des italienischen Herstellers Alpitronic und wird in der Schweiz von der Simplee AG vertrieben. Spannendes Detail: Sie wurde mit Hilfe massiver Träger an der Decke der Garage montiert und auch über die Decke er - schlossen. Dies ist platzsparend und ideal für die Raumverhältnisse in der Garage, in der die Notfall- und Einsatzfahrzeuge bereitstehen.
Einheitliche Unterverteilungen
Versorgt wird die Station über eine BEV-Unterverteilung, die speziell für Ladestationen konzipiert ist. Sie folgt einem fixen Konzept der Flughafen Zürich AG. Die Elektroplanungsabteilung hat eine einheitliche Struktur entwickelt, gemäss der alle Unterverteilungen für Elektromobilität auf dem gesamten Flughafenareal identisch aufgebaut werden.
Der Aufbau mit dem Stromschienensystem PrismaPlus von Schneider Electric ermöglicht bei Bedarf auch einen modularen Ausbau. Kommt eine DC-Station hinzu, lässt sie sich dank diesem Aufbau steckbar einfach ergänzen. Zur Überwachung der Leistungsschutzschalter ist die Unterverteilung ins Techniknetzwerk der Flughafen Zürich AG integriert.
Simplee AG unterstützte bei der Planung und Umsetzung der Anlage und zeichnete auch für die Inbetriebnahme vor Ort verantwortlich. Gemeinsam mit dem Team von Schutz und Rettung Zürich wurde sichergestellt, dass die Station nicht nur technisch funktioniert, sondern auch in den anspruchsvollen Alltag integriert werden kann. Nach einem kurzen Check der Installationen vor Ort wurde die Kommunikation mit dem Backend eingerichtet. Anschliessend folgten die Netzprüfung, die Softwarekonfiguration, ein Firmware-Update sowie die Einbindung in das übergeordnete Lastmanagement (siehe Box). Wichtig war insbesondere die saubere Abstimmung mit der bestehenden Energieinfrastruktur, um Netzbelastungen im Einsatzbetrieb zu vermeiden.
Technische Prüfung
Ein entscheidender Teil der Inbetriebnahme war die technische Prüfung der DC-Ladestation. Yves Lächler, Techniker bei Simplee, kennt sich nicht nur mit der Ladestation selbst aus, sondern ist auch ein ausgewiesener Fachmann für Elektrotechnik, Messtechnik und Energieversorgung. Zum ersten Mal setzte er für die Prüfung den neuen Metrel A 1732 DC EVSE Adapter ein.
Dieses Prüfgerät ermöglicht es, die DC-Seite der Ladestation ohne Fahrzeug zu testen und in Verbindung mit einem Installationstester auszumessen. Erst nachdem alle Werte geprüft und die Kommunikation mit dem Backend sichergestellt waren, wurde der elektrische Firmenwagen angeschlossen. Zum Abschluss wurde die Ladeeinheit unter realen Bedingungen getestet, inklusive RFID-Zugangsprüfung und Ladevorgang mit einem Einsatzfahrzeug. Die wichtigsten Schritte der Inbetriebnahme haben wir in der Box unten zusammengefasst.

Fazit
Schon heute wird die Station im Feuerwehrgebäude rege genutzt. Und da Schutz und Rettung aufgrund des Nachhaltigkeitsstandards der Stadt Zürich für die Beschaffung von Fahrzeugen zunehmend Elektrofahrzeuge einsetzen muss, wird die Ladestation auch künftig eine grosse Rolle spielen oder sogar mit einer zweiten ergänzt. Die Verteilung dafür ist schon vorgesehen.
Und wie eingangs erwähnt: Eine 11-kW-Wallbox wäre hier zu langsam, denn die Fahrzeuge müssen auch nach kurzen Einsätzen schnell wieder voll einsatzbereit sein. Die neue 50-kWStation passt somit sehr gut zum Betrieb. Sie lädt zügig und lässt sich ohne grossen Aufwand in die bestehende Netzinfrastruktur einbinden. Genau das braucht es im Alltag.
Praxis-Check: Inbetriebnahme DC-Station
Die Inbetriebnahme einer DC-Schnellladestation gliedert sich in folgende zu dokumentierende Schritte:
• Sichtprüfung der Installation vor Ort (mechanische Befestigung, Leitungsführung, Schutzabdeckungen)
• Nachziehen von Schrauben gemäss Angaben des Herstellers mit Drehmoment-Schlüssel (Transportschäden)
• Kontrolle der bauseitigen Schutzgeräte gemäss den Anforderungen von Alpitronic (z.B. Erdung, FI-Schutz, Leitungsschutz, Kontrolle der Einstellungen)
• Spannungsprüfung am Einspeisepunkt. Kann die Säule gefahrlos eingeschaltet werden?
• Einschalten 400/230 V-Versorgung, Hochfahren der Station
• Verbinden mit Netzwerk und Internet
• Einbinden in das Netzwerk des Kunden (IP-Adressen usw.)
• Kommunikationstest mit dem Backend (z. B. via OCPP)
• Zugriff auf Weboberfläche, Installieren von Update
• Firmware-Update und Softwarekonfiguration (z.B. Ladestrategie, Anzeige, Nutzerverwaltung)
• Grundeinstellungen und Lastmanagement einrichten.
• Verwendung des Metrel A 1732 DC EVSE Adapters zur Simulation eines Fahrzeugs
• Prüfung von Ausgangsspannung, DC-Strom und Sicherheitsfunktionen (z.B. Isolationsüberwachung)
• RFID-Zugangstest (Freischaltung über Nutzerkarte)
• Funktionstest mit realem Fahrzeug (z.B. Einsatzwagen von Schutz und Rettung)
Impressum
Textquelle: René Senn
Bildquelle: Michael Donadel
Informationen
Veröffentlicht am: