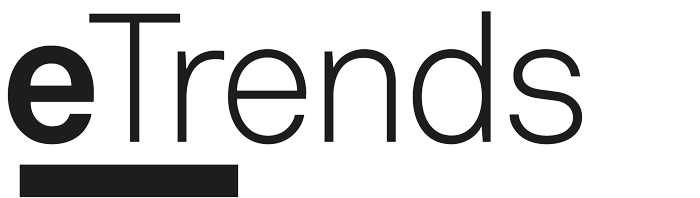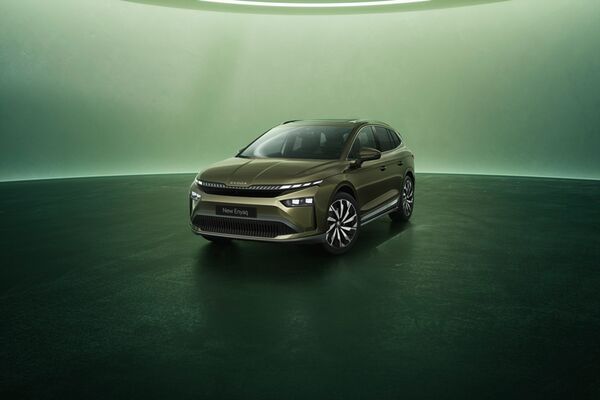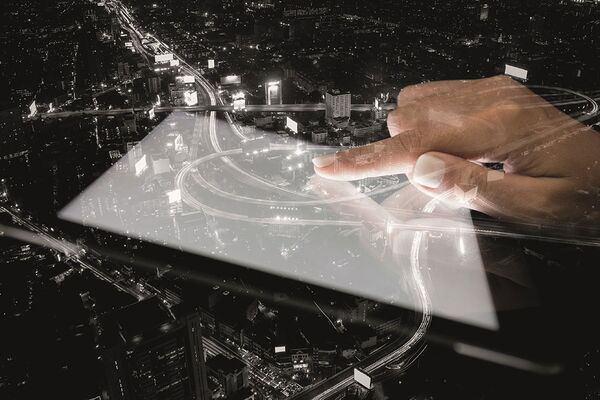Die Autoindustrie steckt mitten in ihrer grössten Transformation seit 100 Jahren. Helmut Ruhl, CEO der AMAG-Gruppe, erklärt, warum er die Branche nicht in der Sackgasse sieht und welche Chancen sich aus der Krise eröffnen.
Von Eugen Albisser (Text) und Swissmem (Bilder)
Die Grundlage dieses Artikels bildet ein Vortrag von Helmut Ruhl, CEO der AMAG-Gruppe, den er im Rahmen des 23. Swissmem-Symposiums in Zürich hielt – einer Veranstaltung, die jedes Jahr zentrale Fragen der Industrie und ihrer Zukunft aufgreift.
Helmut Ruhl betritt das Podium, und schon nach wenigen Minuten ist klar: Dieser Mann ist kein Verwalter des Status quo. Er spricht vom «VUCCA»-Zeitalter, von Volatilität, Uncertainty, Chaos, Contradiction und Ambiguität, das sich über die Autoindustrie gelegt hat. Wer glaubte, der Wandel würde linear verlaufen, habe sich geirrt. Vernetzte Fahrzeuge, autonome Systeme, geteilte Mobilität und vor allem die Elektrifizierung würden die Branche in einer Geschwindigkeit verändern, die selbst erfahrene Manager unterschätzt hätten. «In zehn Jahren verändert sich mehr als in den vergangenen hundert», sagt Ruhl.
Doch während Märkte wie China in einem gnadenlosen Preiskampf stecken und in den USA Protektionismus das Geschäft erschwert, verweist Ruhl auf Europa. Dort baut Volkswagen, Mutterhaus von AMAG, die Produktion radikal um. Gigacasting, Software-defined Vehicle, neue Plattformen: Das Auto wird zum Computer auf Rädern. Und es ist diese Perspektive, die Ruhl mit einem leichten Lächeln verteidigt. «Ob Sackgasse oder Neuanfang, das ist eine Frage der Perspektive.»

Innovation gegen den Abgesang
Die nackten Zahlen schmerzen. Porsche minus 71 Prozent, Audi minus 45 Prozent – und das im Halbjahr. Doch Ruhl bleibt bei der Linie: Nicht jammern, sondern Chancen suchen. Dass Volkswagen zuletzt als innovativster Autokonzern der Welt ausgezeichnet wurde, ist für ihn kein Zufall. Modelle wie der VW ID.3 GTX mit 604 Kilometern Reichweite oder der Audi A6, der in zehn Minuten Energie für 300 Kilometer lädt, sollen den Beweis antreten. Auch die Zulieferindustrie bleibt nicht verschont, Continental spaltet sich, baut Personal ab, wächst dann wieder. Es ist ein ständiges Beben, und doch, so Ruhl, öffnen sich Türen, wenn man rechtzeitig die Richtung wechselt.
«Never let a good crisis go to waste», zitiert er Winston Churchill – eine Mahnung, dass jede Krise auch eine Einladung ist, alte Strukturen hinter sich zu lassen.
Die Schweiz als Labor
Ruhl nimmt seine Zuhörer mit nach Hause, in den Schweizer Markt. Dort zeigt sich, dass selbst nach sechs schlechten Autojahren – ein Viertel weniger Neuwagen als früher – AMAG Marktanteile gewinnt. «Wir sind mit grossem Abstand Marktführer bei Elektrofahrzeugen», betont er. In den Top Ten finden sich gleich mehrere Modelle des Konzerns, vom Skoda Enyaq bis zum Porsche Macan. Der ID.7 schafft auf Schweizer Strassen fast 800 Kilometer am Stück, und der Skoda Elroq ist günstiger als mancher Verbrenner. Damit, so Ruhl, beantworte man die drängenden Fragen der Kundinnen und Kunden: Preis, Reichweite, Ladeinfrastruktur.
Dass die Schweiz ein ideales Testfeld ist, zeigt sich auch bei neuen Technologien: Laut Prognosen werden bis 2035 ADAS-Systeme (Advanced Driver Assistance Systems) die Kollisionsraten um bis zu 20 Prozent reduzieren – und damit Werkstattumsätze ebenso wie Unfallzahlen.
Kreislaufwirtschaft als nächste Phase
Was aber geschieht mit dem CO₂-Rucksack? Ruhl rechnet vor: Ein VW Tiguan verursacht über seinen Lebenszyklus 50 Tonnen CO₂. Ein ID.4, betrieben mit europäischem Strommix, reduziert dies um ein Drittel. Mit Schweizer Wasserkraft und Solarstrom sinkt der Wert um weitere 50 Prozent. «73 Prozent weniger Emissionen – das ist die Realität», sagt er. Deshalb investiert AMAG nicht nur in Elektromobilität, sondern auch in Photovoltaik mit Helion oder in Solartreibstoffe mit dem ETH-Spin-off Synhelion. Es geht um Kreislaufwirtschaft, um Recyclinglösungen, um Fabriken, die nahezu CO₂-neutral arbeiten.
Kooperation statt Konfrontation
Hier setzt Ruhl zu einem Seitenblick über den Atlantik an. In den USA gelte «The art of the deal», Gewinner nähmen alles. In der Schweiz hingegen funktioniere die «Kunst des Kompromisses». Ein Modell, das Wohlstand gleichmässiger verteile und die Transformation zu einer Gemeinschaftsaufgabe mache. AMAG gehe diesen Weg über Kooperationen und Ökosysteme. Mit Energieunternehmen, mit der Politik, mit Start-ups. In Zug entstehe ein virtuelles Kraftwerk, bidirektionales Laden werde praktisch erprobt, autonomes Ride-Pooling soll den ÖV ergänzen. Ruhl will eine «Swiss Alliance», die europäischen Technologien eine Bühne gibt – ein Gegenentwurf zu chinesischen und amerikanischen Lösungen.
Mehr Menschen, weniger CO₂
Am Ende des Vortrags zieht Ruhl Bilanz. Vor Corona war vieles anders, heute stehe AMAG stabiler da. 7600 Mitarbeitende, 15 Prozent mehr als damals, dazu 800 Lernende – ein Plus von 8 Prozent. Marktanteil über 30 Prozent, Umsatz knapp fünf Milliarden Franken. Gleichzeitig 30 Prozent weniger CO₂, dreimal so viel Photovoltaik zugebaut wie Elektroautos verkauft. «Wir haben uns umgedreht», sagt Ruhl. «Wir sehen keine Sackgasse, sondern eine offene Strasse in die Zukunft.»
Mehr zum Swissmem-Symposium 2025
Weitere Artikel zum Symposium finden Sie in unserem Schwestermagazin «Technik und Wissen» (neu: Technische Rundschau). Auf der Landingpage erwarten Sie ausführliche Berichte über die Vorträge und Roundtable-Gespräche
Veröffentlicht am: